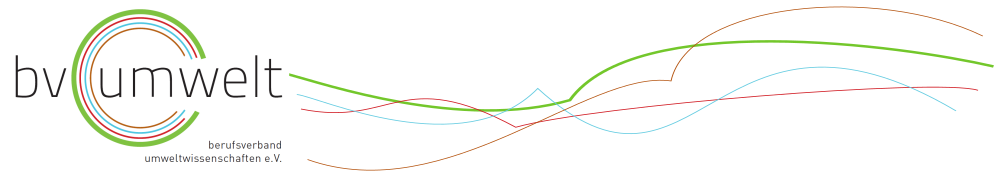Am 16. September 2023 führte der 2. Vorsitzende des BV-Umwelt, Herr Dipl.-Umweltwissenschaftler Jörg Drewenskus, unsere Mitglieder und weitere Interessierte durch die renaturierte Lenneaue in Hagen-Halden. Die Exkursion war mit 17 Teilnehmern sehr gut nachgefragt.
Die Lenne-Renaturierung in Hagen ist 2019 gestartet. Der erste Bauabschnitt, etwa 800 Meter lang, wurde Anfang 2021 fertiggestellt. Im Februar 2022 ist auch der zweite Bauabschnitt abgeschlossen worden, sodass wir auf einer Fließlänge von 1,5 Kilometern eine renaturierte Flusslandschaft haben.
Die Lenne ist an der Mündung in die Ruhr in Hagen-Kabel fast so groß wie die Ruhr. Sie ist somit der größte und wichtigste Nebenfluss der Ruhr. Hier fließen zwischen 10 Kubikmeter Wasser pro Sekunde bei niedrigen bis 30 Kubikmeter bei mittleren Wasserständen ab. Die Renaturierung ist landesweit bedeutsam und auf einer Ebene sowohl mit den Ruhr-Renaturierungen als auch den Lippe-Renaturierungen zu sehen.
Etwas außerhalb der großen Öffentlichkeit, benachbart zum Gewerbegebiet Hagen-Halden, gegenüber dem Frachtzentrum der Deutschen Post, vollzieht sich (nicht nur für Hunde- und Natur-Liebhaber) eine bedeutsame Gewässer-Renaturierung. Zur Gewinnung des großen Gewerbegebietes ist die Lenne hier in den 1970 er Jahren von ihrem wilden Lauf – sie floss in einem großen Bogen durch die Aue – in ein kanalartiges Profil mit der festen Breite von 30 Metern, Steinschüttungen und Rasengitterstein-Böschungen gepresst worden.
Seit über 30 Jahren ist es Auftrag für die Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, Gewässer wieder in naturnahe Zustände zu versetzen. Das Dezernat 54, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz, unterstützt diese Aufgabe durch fachliche Beratung der Gewässerunterhaltungsträger und finanzielle Förderung von Renaturierungsmaßnahmen. Im Falle der Lennerenaturierung ist das Dezernat 54 auch für die Genehmigung der Maßnahme verantwortlich. Beflügelt wurde diese Aufgabe zusätzlich durch die seit 2000 gültige EG-Wasserrahmenrichtlinie, die einen guten Zustand der Fließgewässer bis 2027 vorsieht. So ist die große Lenne-Renaturierung in drei Bauabschnitten sicherlich ein Meilenstein zur Erreichung dieses Ziels.
Im Zuge der Renaturierung der Lenne wurde der Fluss auf eine Breite von bis zu 100 Metern aufgeweitet. Die Maßnahme ist, wie bereits erwähnt, in drei Abschnitte aufgeteilt. Die ersten beiden zusammenhängenden Abschnitte von Flusskilometer 2,67 bis 4,00 sind im Frühjahr 2021 bzw. 2022 fertig gestellt worden. Dafür hat das Land Nordrhein-Westfalen über die Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 54, bisher 2,68 Millionen Euro Fördermittel an die Stadt Hagen ausgezahlt. Diese lässt die Renaturierungsmaßnahmen über ihre Wirtschaftsbetriebe Hagen (WBH) abwickeln, die schon eine fast 20-jährige Erfahrung mit Fließgewässer-Renaturierungen vorweisen können.
Der dritte Bauabschnitt von Kilometer 4,63 bis 5,50 wird ab Frühjahr 2023 umgesetzt. Dafür stehen 3,8 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Die Gesamtausgaben der Lenne-Renaturierung in Hagen-Halden liegen bei 7,2 Millionen Euro. Die Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen wird in der Form der Anteilfinanzierung in Höhe von 90 Prozent der Kosten gewährt. Das sind 6,48 Millionen Euro, die als Zuschuss an die Stadt Hagen ausgezahlt werden, bei einem städtischen Eigenanteil von 720.000 Euro.
Lenne ist wieder erlebbar und voller Leben
Dem Besucher stellt sich heute eine vielfältige und erlebnisreiche Flusslandschaft dar. Vorbei sind die Zeiten, als die Lenne von dichten Ufergehölzen geschützt in einer Art grünem Tunnel floss und davor eintönige Auewiesen auch wenig optische Abwechslung boten. Nun haben wir ein buntes Mosaik von Schotterinseln, Uferinseln, Schlammfluren, Baum-Inseln im Fluss, davor angeschwemmte Baumstämme, die der Wasserwirtschaftler Totholz nennt. Die Natur hat sich diesen Bereich schon mehr oder weniger während und kurz nach der Bauphase erobert. Wasservögel sind präsent, Graureiher und Kormorane jagen hier nach Fischen. In den flachen Wasserbereichen lässt sich in den Sommermonaten die Fischbrut beobachten, wie sie sich in zehntausender Zahl als Schwarm bewegt und auf Schatten am Ufer fluchtartig reagiert.
Der große Fluss Lenne ist jetzt für die Hagener Bevölkerung wieder voll erlebbar und vor allem auch sichtbar ins Landschaftsbild zurückgekehrt. Während wir früher die Lenne nur noch von Brücken einsehen konnten, bietet sich jetzt dem Spaziergänger am nahen Rad- und Wanderweg ein spannendes Fluss-Refugium, ja quasi der Amazonas an der Lenne.
Dazu wurden beidseitig Uferbereiche abgetragen und erhaltenswerte Weiden auf Inseln stehen gelassen. Wir haben jetzt sowohl Steilufer im Auenlehm als auch viele Ufer- und Inselbänke mit dem plattigen Schotter des silikatischen Grundgebirges geschaffen (s. Luftbilder). Uferschwalben und Flussregenpfeifer sind schon gesehen worden! Die Uferschwalben sind Zugvögel, die von Mai bis Anfang September in Ufersteilwänden (Lehm) in Kolonien brüten und dazu etwa 70 Zentimeter tiefe Brutröhren graben. Der Flussregenpfeifer ist ein Einzelgänger und ein typischer Bewohner von vegetationsfreiem Fluss-Schotter. Er baut auch kein Nest, sondern legt seine Eier direkt zwischen den Schottersteinen ab, die perfekt an diese farblich angepasst sind. Daher ist es für seinen Bruterfolg so wichtig, dass die Schotterbereiche während der Brutzeit nicht von Menschen begangen werden, da sie die Eier wegen der guten Tarnung leicht unbedacht zertreten könnten bzw. die winzigen Küken aufscheuchen und von ihren Eltern abschneiden würden.
Archiv des Autors: Jörg Drewenskus
Bericht vom Diskussionsabend am 23.11.2022: Auswirkungen eines Extrem-Hochwassers im Juli 2021 in Hagen (Westfalen) auf die Hydromorphologie und -biologie
Am 14./15. Juli 2021 kam es zu einem Extrem-Hochwasser an der Volme und ihren Nebengewässern sowie zwei Nebengewässern der Lenne im Stadtgebiet Hagen. Vorausgegangen waren anhaltende Starkregen mit lokal bis zu 250-285 mm Niederschlag in 21 h. Es kam zu katastrophalen Schäden und Zerstörungen an Ufermauern, Brücken, Straßen, Eisenbahnlinien, Versorgungsleitungen und -einrichtungen, Gewerbe- und Industriehallen sowie an Wohngebäuden. Daneben wurden durch das Extrem-Hochwasser neue Strukturelemente in und an Fließgewässern geschaffen. Da im Volme- und Lenne-Einzugsgebiet die Gewässer-Typen 5 und 9.1, „Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche“ bzw. „Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse“ vorherrschen, kam es hier zu umfangreichen, kilometerweiten Sedimentverlagerungen der vorherrschenden Kornfraktionen Kies, Schotter und Steine. Durchlässe und Brückenbauwerke wurden daher teilweise komplett mit Sohlsubstrat und Treibgut verklaust oder sogar zerstört. Es kam in gefällereichen Gewässerabschnitten zu massiver Sohlerosion bis auf das Grundgebirge. Es stellten sich vor allem an Nebengewässern nahezu Gebirgsbach ähnliche Initialzustände ein, mit von jedem Aufwuchs befreiten Substraten. Es wurden umfangreiche Tiefrinnen (> 1 m), Auskolkungen, Ufer- und Inselbänke, Schnellen und Rauschen, Steilufer, Sturzbäume, Umlaufbäume, Totholzansammlungen etc. geschaffen. Es kam zu Gewässeraufweitungen und Laufverlagerungen bzw. -verzweigungen sowie zu umfangreichen Aufschotterungen.
Die neu geschaffenen Gewässerstrukturen haben für eine (temporäre) ökologische Aufwertung der vormals oft stark veränderten Gewässer gesorgt, die teilweise im Zuge der Hochwasserfolgenbeseitigung leider wieder entfernt wurden.
Zur Einschätzung des Einflusses des Hochwassers auf die Gewässergüte wurden chemische und biologische Untersuchungen durch das LANUV NRW durchgeführt. Beim Makrozoobenthos ist kein Totalausfall der Lebensgemeinschaft zu verzeichnen, auch wenn die Individuendichte einiger Taxa geringer als üblich erscheint.
Nach bisheriger Einschätzung hat das Hochwasserereignis in der aquatischen Umwelt der betroffenen Region keinen dauerhaften Schaden hinterlassen. Eine befürchtete Ölpest blieb aus. Ebenso konnten erhebliche und akut gefährliche Schadstoffeinträge und -freisetzungen nicht festgestellt werden.
Bericht von der BV Umwelt Nachhaltigkeitstagung am 10. September 2022 an der Universität Essen
Wir haben am 10.09.2022 einen guten Tagungsverlauf mit thematisch sehr unterschiedlichen, die verschiedensten Bereiche der Nachhaltigkeit und des Ressourcenschutzes beleuchtenden, Beiträge gehabt. Die zahlreichen Rückfragen sowie die lebhaften Diskussionen im Netz und Hörsaal zeigen das Interesse am Thema in der Gesellschaft und tragen hoffentlich dazu bei, dass wir in unseren jeweiligen Bereichen das Notwendige einbringen und auch umsetzen werden!!
Der erste Referent, Dr. Wolfgang Spangenberg, ist promovierter Politologe sowie Diplom-Biologe und -Ökologe. Er ist Research Coordinator, Vice Chair, beim Sustainable Europe Research Institute SERI Germany e.V. und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des BUND e.V.. Dr. Spangenberg gab in seinem Eingangsreferat einen globalen Überblick über den Zustand der Ökosysteme der Erde. Plakativ nannte er es so: „die Party ist vorbei“. Fünf der neun planetarischen Grenzen sind bereits überschritten. Wir haben mehrere Kipppunkte des Klimasystems erreicht oder sogar überschritten. Wir wissen nicht, ob es stabile Zustände des Klimasystems bei einer Erderwärmung größer gleich 1,5° geben wird. Soziale Errungenschaften werden mit Grenzüberschreitungen bezahlt. Hinzu kommt, dass die Grenzen schneller überschritten werden, als soziale Erfolge erzielt werden können. Obwohl die Klimakrise die einzige ist, die einigermaßen ernst genommen wird, wird die Dringlichkeit nicht realisiert. Nach dem Scheitern des Biden-Programms und dem Richterspruch ist eine effektive Klimapolitik in den USA nicht mehr möglich. Die 2°-Ziele werden überschritten. Die Menschheit geht vom fossilen in ein neues Metall-Zeitalter über, mit mehr Stoffströmen und Materialverbrauch, mehr sozialen Verwerfungen in und zwischen den Ländern sowie mehr Abhängigkeiten von autoritären und diktatorischen Regimes. Insofern sind die gegenwärtig propagierten Lösungen nur „Business as usual by other means“. Der gemeinsame Nenner, die Überschreitung der ökologischen Grenzen durch unser Wirtschaften, wird nicht erwähnt. Dr. Spangenberg prognostiziert einen Wechsel von der Nachhaltigkeit zur Sicherheit. Ressourcensicherheit wird wichtiger und wird wohl militärisch gesichert werden, denn der Ideologiewechsel vom Neoliberalismus zum Neoimperialismus sei seit 20 Jahren vollzogen. Dr. Spangenberg konstatiert, dass immer Geld für Waffen zur Verfügung stünde, aber nicht für Natur und Soziales. Ständig neue Krisen führten zu einer allgemeinen Resignation, auch gegenüber der Umweltkrise. Dabei ginge es um mehr als Wirtschaftswachstum, es gehe vor allem um gute Arbeit als Teil eines guten Lebens.Die prognostizierten Folgen ab 2050 sind sehr düster: Dürren reduzieren die Lebensmittelsicherheit, Wasserknappheit erfordert eine Rationierung, Waldbrände und Flutwellen zerstören Habitate, Hitzewellen fordern Todesopfer. Das Systemversagen unserer Wirtschaft erfordert nicht Optimierung, sondern einen Systemwandel, technisch wie gesellschaftlich. Gerechtes Teilen bedeutet immer die Beschränkung von Privilegien. Manchmal muss die Freiheit Weniger (zu konsumieren und zu spekulieren) begrenzt werden, um die Freiheit Aller (zu überleben) zu sichern. Dr. Spangenberg sieht große Aufgaben für die Ökologen in der Multikrise. Erstens nicht zu zögern erschreckende Analysen mitzuteilen. Er ruft zum Engagement auf, nicht nur Resillienzelemente zu identifizieren, sondern sie auch umzusetzen. Die Wege müssen zurück zu den planetaren Grenzen, mit radikalen Methoden und ohne Tabus. Es gilt: nur radikal ist realistisch.
Das 2.Referat hielt Dr. Michael Kopatz. Dr. Kopatz ist Sozialwissenschaftler, war Dozent und Projektleiter im Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Von 2007 bis 2008 war er Mitautor der von Misereor und BUND geförderten Studie Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt. Er beschäftigt sich mit Konzepten zur Stärkung der Regional- und Gemeinwohlwirtschaft in Kommunen. Diesen Ansatz nennt er Wirtschaftsförderung 4.0.
Herr Philip Kosse, Master of Geography und frischer Absolvent, war der 3.Referent der Tagung. In seiner Masterarbeit befasste sich Kosse vor allem mit digitaler Bürgerbeteiligung und nachhaltiger Stadtentwicklung am Beispiel Münster. Seine Schwerpunkte sind vor allem Smart City, nachhaltige Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit als solches und im Kontext der Digitalisierung.
4.Referent war Dr. Klaus Krumme. Krumme ist seit 2019 Geschäftsführer des Joint Centre Urban Systems (JUS) an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Er ist ein interdisziplinärer Wissenschaftler, mit Abschluss in Umweltwissenschaften sowie in Geographie, Biologie und Erziehungswissenschaften. Er promovierte innerhalb der Geographie zum Thema „Sustainable Urban-Industrial Supply Systems“ mit Bezug zur transdisziplinären Nachhaltigkeitswissenschaft. Dr. Krumme ist Lehrbeauftragter für Nachhaltigkeit und leitet das Projekt„Integriertes Regionales Klimalabor Nord Jakarta und Hafen (JaC-Lab) (BMBF, 2019-2021). Aus diesem hat er im folgenden berichtet.
Den 4 Vorträgen folgte eine 30 minütige Diskussion.
Im Nachmittagsblock stellte die Referentin Linda Preil, Mitarbeiterin der Firma Einhorn aus Berlin, die nachhaltigen Aktivitäten ihres Arbeitgebers vor. Die Firma Einhorn produziert vegane und nachhaltige Periodenprodukte und Kondome aus regenerativer Landwirtschaft. Firmengründer ist Waldemar Zeiler, der in seinem Buch „Unfuck the economy“ (zusammen mit Katharina Höftmann Ciobotaru sowie einem Vorwort der Nachhaltigkeits-Ökonomin Maja Göpel) die bisherige Wirtschaftswelt auf den Kopf stellt und einen radikalen Umbau zur Nachhaltigkeit und einer Post-Wachstumsgesellschaft fordert. Seine Mitarbeiter, „die Einhörner“ arbeiten selbstbestimmt ohne Hierarchien, wann sie Lust haben, von wo sie wollen, und bestimmen ihr Gehalt weitestgehend selbst. Deswegen gehört die unverkäufliche Firma inzwischen auch sich selbst.
Es folgte die 6.Referentin, Frau Antje Styskal, Bürgermeisterin des Zukunftsdorfes Bollewick in Mecklenburg-Vorpommern, am größten See Deutschlands, der Müritz. Die Bürger des Dorfes leben ihre Vision von einer nachhaltigen Zukunft im Grünen. Sie machen sich nicht nur unabhängig von fossiler Energie, sondern übernehmen auch nachhaltig Verantwortung. Der ehemalige Bürgermeister Bertold Meyer war seit Beginn der 1990er Jahre schier unermüdlicher Motor in diesem Prozess.
- Im Bioenergiedorf Bollewick wird aus regionaler Biomasse der Strombedarf zu 100% und die benötigte Wärme zu 70% gestillt. Dabei werden pro Jahr 623 Tonnen CO2 Ausstoß vermieden.
- Nicht nur die im Dorf lebenden Menschen profitieren von den Anlagen, sondern auch die Felder der ansässigen Landwirte. Dort wird mit den Gärresten gedüngt. Das spart synthetischen Dünger und zeigt, wie Kreisläufe funktionieren.
- Darüber hinaus wurden gläserne Landwerkstätten initiiert, wo ökologische Fleischwaren hergestellt werden. Die Straßenbeleuchtung wurde auf LED umgestellt. Der Ausbau und Betrieb der größten Feldscheune Deutschlands zum Kulturzentrum ist für ein Dorf dieser Größe sensationell. Hier wird Handel mit regionalen Produkten getrieben, aber auch Gastronomie und ein Hotel haben hier eine Heimstatt.
Abschließende Referentin (7) war Frau Rebecca Hummel, Managerin im Transformbar Projekt der Stadt Münsingen in Baden-Würtemberg. In Münsingen, im Biosphärenreservat Schwäbische Alb gelegen, verfolgen der Gemeinderat und die Einwohnerschaft einen breit aufgestellten Ansatz von Nachhaltigkeit. Die ökologische, die ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit finden sich in allen kommunalpolitischen Entscheidungen wieder. Ziel ist es, möglichst viele Akteurinnen und Akteure aus der Bevölkerung und der lokalen Wirtschaft von diesen Zielen zu überzeugen und mitzunehmen. Folgende Vorhaben sind bereits umgesetzt:
- Mobilitätszentrum: Direkt am Bahnhof entstand ein Elektromobilitätszentrum, an dem Touristen und Einheimische E-Bikes und ein E-Auto mit vorgeschlagenen Routen ausleihen können. Die Stadt betreibt das Mobilitätszentrum gemeinsam mit einem lokalen Fahrradhändler.
- Regionale Produkte: In Zusammenarbeit mit dem Biosphärengebiet ist es in den vergangenen Jahren gelungen, viele regionale Produkte, vor allem auch alte Sorten (z.B. AlbLinsen, AlbLamm, Albschneck, Albbüffel) am Markt zu platzieren. Dadurch wird eine regionale Wertschöpfung erreicht und die Produkte aus der Region, welche zum Teil bereits vom Markt verschwunden waren, rücken wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung.
- Naturerlebnisgebiet Beutenlay: Direkt am Stadtrand liegt das ca. 100 ha große Naturreservat. Eine Besonderheit ist das Feld-Flora-Reservat, in dem die über Jahrhunderte bewährte Dreifelderwirtschaft auf der Schwäbischen Alb dargestellt wird. Ebenfalls wird die Haltung von Waldschafen in diesem Gebiet praktiziert und die Veränderungen im Wald können beobachtet werden.
- Erneuerbare Energien: Durch einen guten Energiemix aus PV, Wind und Biomasse gelingt es der Stadt Münsingen, den Strombedarf der privaten Haushalte sowie der kleinen und mittleren Unternehmen komplett zu decken. Vor allem durch die zur Verfügung Stellung von Dachflächen konnte die Stadt Münsingen in den vergangenen Jahren die Leistung stetig ausbauen.
- Biotopverbund/Landschaftspflege: Durch die Unterhaltung und Pflege der Buchenwälder, der Wacholderheiden sowie anderer Biotope erhält Münsingen die Kulturlandschaft. Durch den Erhalt wird ein großer Beitrag zur Biodiversität geleistet. Durch Lehrpfade und die Führung durch ausgebildete AlbGuides werden die Landschaften erlebbar und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung.
Bericht zur ökologischen Exkursion an die renaturierte Emscher in Dortmund-Mengede / Stadtgrenze Castrop-Rauxel am 26.9.2020
Galerie

Diese Galerie enthält 8 Fotos.
Der 2.Vorsitzende des BV-Umwelt, Diplom-Umweltwissenschaftler Jörg Drewenskus, führte die Gruppe entlang der Emscherrenaturierung in Dortmund-Mengede. Er gab zunächst eine Übersicht zum 1992 begonnenen ökologischen Umbau des Emschersystems. Fotos: Martina Stengert